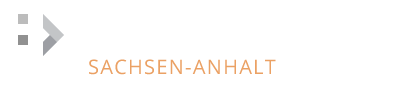Effects of Cr addition on Ti implant alloys (Ti-Cr/Ti-Al-V-Cr) to enhance corrosion and wear resistance
Herbster, Maria ; Garke, Bernd ; Harnisch, Karsten ; Michael, Oliver ; Lieb, Alexandra ; Betke, Ulf ; Könnecke, Mandy ; Heyn, Andreas ; Kriegel, Paulina ; Thärichen, Henrike ; Bertrand, Jessica ; Krüger, Manja ; Halle, Thorsten
MOFs bestehen aus einem organischen Teil (Linker/Ligand) und Metall-Ionen oder Metalloxid-Clustern (Knoten), welche sich zu dreidimensionalen Netzwerken verbinden. Innerhalb der Substanzklasse der MOFs sind vor allem die porösen Vertreter interessant, da dort eine sehr große (innere) Oberfläche auftritt, die genutzt werden kann.
Da MOFs bei der Synthese stets als feine Pulver anfallen, sind sie zumeist zunächst für eine industrielle Anwendung nicht geeignet. Es ist deshalb nötig die MOFs in eine besser verwendbare Form zu bringen. Hierfür gibt es z. B. die Möglichkeit der Aufbringung des MOFs als Schicht auf ein Trägermaterial oder die Erzeugung von Granulien oder größeren Monolithen.


Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit von Prof. Bertrand richtet sich auf die Untersuchung der molekularen Mechanismen der Knorpel-Remodellierung unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. Dies umfasst die Mechanismen der enchondralen Ossifikation und pathologischen Prozesse, wie Osteoarthrose, Frakturheilung und rheumatoide Arthritis. Die Kernhypothese ihrer Arbeit ist, dass es zu einer erneuten Aktivierung embryonaler Signalkaskaden kommt, die sowohl während der Frakturheilung, als auch der Osteoarthrose aktiv sind und denen der enochondralen Ossifikation in der Embryonalentwicklung in großen Teilen gleichen.