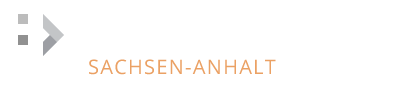Kulte im Kult Bedeutung und Funktion des sakralen Mikrokosmos in extraurbanen griechischen Heiligtümern unter besonderer Berücksichtigung von Didyma (Türkei)
Projektleiter:
Projektbearbeiter:
Bumke,
Breder,
Kaiser,
Mehnert,
Reichardt
Projekthomepage:
Finanzierung:
Gegenstand des Forschungsprojektes sind die außerhalb der städtischen Bereiche gegründeten griechischen Heiligtümer. In der Regel sind sie mit einer Hauptgottheit verbunden, neben der jedoch auch zahlreiche weitere Gottheiten verehrt wurden. Während die Koexistenz verschiedener Gottheiten an sich kein unbekanntes Phänomen ist, wurde bislang jedoch kaum genauer untersucht, inwieweit sich ihre verschiedenen Funktionsbereiche im Gefüge einer einheitlichen sakralen Zone ergänzen, deren religiöse Primär-Ausrichtung durch eine Hauptgottheit und ihre spezifischen Qualitäten festgelegt war. Eine Untersuchung der sakralen Strukturen extraurbaner Heiligtümer und ihres rituellen Gesamtgefüges ist übergeordnetes Ziel des Forschungsvorhabens. So gilt es, innerhalb des jeweils topographisch klar definierten sakralen Raumes, der von einer Hauptgottheit mit bestimmten Wirkungsbereichen auch inhaltlich bestimmt ist, die Funktion der Nebenkulte im Hinblick auf den Gesamtorganismus, insbesondere die rituelle Interaktion bzw. Kommunikation mit den religiösen Primäraspekten, zu erschließen.
Eine Antwort auf die Frage nach den Funktionen solcher untergeordneten Kultbezirke wird man vor allem von den schriftlichen Zeugnissen und den archäologischen Befunden selbst erwarten dürfen, die mit Hilfe einer Datenbank systematisch aufgenommen und ausgewertet werden. Aussagekräftig können beispielsweise die Lage der Kultbezirke, ihre Ausstattung und soweit identifizierbar auch das Spektrum von Weihegaben und Kultgeräten sein, sind diese doch für die Zusammensetzung der Kultgemeinschaft und spezifische Kulthandlungen zuweilen aufschlussreich, wobei auch das Fehlen charakteristischer Votivgruppen diesbezüglich durchaus relevant sein kann.
Die systematische Erschließung des sakralen Mikrokosmos extraurbaner Heiligtümer bildet den übergreifenden theoretischen Teil des Akademieprojektes, während die konkrete Untersuchung eines der bekanntesten extraurbanen Heiligtümer der Antike die übergreifende Forschung flankiert und einen Präzedenzfall für diesen Typus darzustellen vermag. Es handelt sich hierbei um das zu Milet gehörende Orakelheiligtum von Didyma an der kleinasiatischen Westküste, das trotz seiner großen Bedeutung immer noch in weiten Teilen unausgegraben ist. So verbindet man mit ihm in der Regel auch heute noch allein den monumentalen, zu Beginn des 20. Jhs. freigelegten Apollontempel, der zu den am besten erhaltenen Tempeln der Antike zählt. Aus der umfangreichen schriftlichen Überlieferung wissen wir jedoch, dass es in Didyma daneben noch weitere, wenn auch kleinere Heiligtümer verschiedener Gottheiten gegeben haben muss. Insofern bestehen hier äußerst günstige Voraussetzungen und Möglichkeiten, durch gezielte Ausgrabungen auch auf primärer Ebene einen Zugang zum Verständnis der religiösen Strukturen eines extraurbanen Heiligtums zu erlangen.
Eine Antwort auf die Frage nach den Funktionen solcher untergeordneten Kultbezirke wird man vor allem von den schriftlichen Zeugnissen und den archäologischen Befunden selbst erwarten dürfen, die mit Hilfe einer Datenbank systematisch aufgenommen und ausgewertet werden. Aussagekräftig können beispielsweise die Lage der Kultbezirke, ihre Ausstattung und soweit identifizierbar auch das Spektrum von Weihegaben und Kultgeräten sein, sind diese doch für die Zusammensetzung der Kultgemeinschaft und spezifische Kulthandlungen zuweilen aufschlussreich, wobei auch das Fehlen charakteristischer Votivgruppen diesbezüglich durchaus relevant sein kann.
Die systematische Erschließung des sakralen Mikrokosmos extraurbaner Heiligtümer bildet den übergreifenden theoretischen Teil des Akademieprojektes, während die konkrete Untersuchung eines der bekanntesten extraurbanen Heiligtümer der Antike die übergreifende Forschung flankiert und einen Präzedenzfall für diesen Typus darzustellen vermag. Es handelt sich hierbei um das zu Milet gehörende Orakelheiligtum von Didyma an der kleinasiatischen Westküste, das trotz seiner großen Bedeutung immer noch in weiten Teilen unausgegraben ist. So verbindet man mit ihm in der Regel auch heute noch allein den monumentalen, zu Beginn des 20. Jhs. freigelegten Apollontempel, der zu den am besten erhaltenen Tempeln der Antike zählt. Aus der umfangreichen schriftlichen Überlieferung wissen wir jedoch, dass es in Didyma daneben noch weitere, wenn auch kleinere Heiligtümer verschiedener Gottheiten gegeben haben muss. Insofern bestehen hier äußerst günstige Voraussetzungen und Möglichkeiten, durch gezielte Ausgrabungen auch auf primärer Ebene einen Zugang zum Verständnis der religiösen Strukturen eines extraurbanen Heiligtums zu erlangen.
Anmerkungen
Das Projekt wird von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste sowie von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften gefördert. Förderungszeitraum: 01.02.2009 bis 31.12.2021
Schlagworte
Didyma, Griechische Heiligtümer, Kulttopographie, extraurbane Heiligtümer
Kooperationen im Projekt
Publikationen
Die Daten werden geladen ...
Kontakt

Prof. Dr. Helga Bumke
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas
Universitätsplatz 12
06099
Halle (Saale)
Tel.:+49 345 5524019
weitere Projekte
Die Daten werden geladen ...