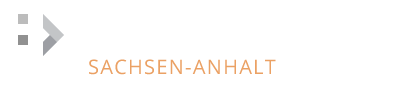Chronosequenz der Bodendegradation durch Winderosion in der semi-ariden Kulundasteppe Westsibiriens
Projektleiter:
Finanzierung:
Die Winderosion tritt in der Kulundasteppe insbesondere während der trockenen Phasen im Frühling auf, wenn die Felder noch brachliegen und starke Westwinde auftreten (Larionov et al. 1997; Meinel 2002). Besonders problematisch erscheinen aber auch die oftmals schlechten Zustände der Windschutzstreifen und damit deren mangelnde Effektivität (Paramonov & Ishutin 2009). Insgesamt sind die Bodenschädigungen in den dem Altaigebirge vorgelagerten Steppen wesentlich stärker verbreitet und intensiver als in anderen südsibirischen Agrarsteppen. Burlakova (1999) zeigte, dass die Verstärkung der Intensität und räumlichen Ausdehnung dieser Bodendegradationsphänomene dazu führte, dass im Gebiet der Kulundasteppe heute 60-70 % der ackerbaulichen Flächen durch Erosionserscheinungen und Bodenverschlechterung betroffen sind (Frühauf & Meinel 2003; Meinel & Frühauf 2004).
Bislang gibt es nur wenige Daten zu Boden-Chronosequenzen in der Kulundasteppe, die unmittelbare Bezüge zur Entwicklung der Landnutzung, aber auch zu Bestrebungen des Bodenschutzes deutlich machen. Für die Steppen im europäischen Teil Russlands liegen diesbezüglich nur Einzelbefunde vor (z.B. Larionov et al. 1997). Studien, welche sich auf aride bis semi-aride Gebiete beziehen und diese Fragestellungen thematisieren, wurden oft in anderen Regionen, z.B. in China, der Mongolei, Australien oder Nordamerika durchgeführt und sie untersuchen oft die Verluste der organischen Substanz in Oberböden (z.B. Raupach et al. 1994; Parton et al. 1995; Li et al. 2004, Yan et al. 2013). Weniger im Fokus standen dabei Effekt von Erosionsprozessen auf den Element- bzw. Nährstoffgehalt (Reynolds et al. 2001; Li et al. 2008).
Die Jahresmitteltemperaturen in der Kulundaregion steigen im Vergleich zu anderen Regionen Russlands überdurchschnittlich stark an (Bulygina et al. 2007). Daher wird für die Zukunft eine Verstärkung der Deflationsprozesse erwartet. Die Windschutzstreifen scheinen eine maßgebliche Rolle bei der Eindämmung der Effekte der Winderosion zu haben. Hierbei ist nicht nur deren Erhaltungszustand sondern auch deren räumliche Anordnung von Bedeutung. So bringt Oke (1987) die Reichweite der Schutzwirkung von Windschutzstreifen mit dem 10 bis 15-fachen ihrer Höhe in Zusammenhang. Diesbezügliche Untersuchungen fehlen ebenfalls für die südlichen Steppengebiete Sibiriens.
Bislang gibt es nur wenige Daten zu Boden-Chronosequenzen in der Kulundasteppe, die unmittelbare Bezüge zur Entwicklung der Landnutzung, aber auch zu Bestrebungen des Bodenschutzes deutlich machen. Für die Steppen im europäischen Teil Russlands liegen diesbezüglich nur Einzelbefunde vor (z.B. Larionov et al. 1997). Studien, welche sich auf aride bis semi-aride Gebiete beziehen und diese Fragestellungen thematisieren, wurden oft in anderen Regionen, z.B. in China, der Mongolei, Australien oder Nordamerika durchgeführt und sie untersuchen oft die Verluste der organischen Substanz in Oberböden (z.B. Raupach et al. 1994; Parton et al. 1995; Li et al. 2004, Yan et al. 2013). Weniger im Fokus standen dabei Effekt von Erosionsprozessen auf den Element- bzw. Nährstoffgehalt (Reynolds et al. 2001; Li et al. 2008).
Die Jahresmitteltemperaturen in der Kulundaregion steigen im Vergleich zu anderen Regionen Russlands überdurchschnittlich stark an (Bulygina et al. 2007). Daher wird für die Zukunft eine Verstärkung der Deflationsprozesse erwartet. Die Windschutzstreifen scheinen eine maßgebliche Rolle bei der Eindämmung der Effekte der Winderosion zu haben. Hierbei ist nicht nur deren Erhaltungszustand sondern auch deren räumliche Anordnung von Bedeutung. So bringt Oke (1987) die Reichweite der Schutzwirkung von Windschutzstreifen mit dem 10 bis 15-fachen ihrer Höhe in Zusammenhang. Diesbezügliche Untersuchungen fehlen ebenfalls für die südlichen Steppengebiete Sibiriens.
Schlagworte
Boden-Chronosequenz, Bodendegradation, Kulundasteppe, Winderosion
Kooperationen im Projekt
- Dr. Andrey Bondarovich, Altai State University, Koordinator des KULUNDA-Projektes in Russland
- Prof. Dr. Alexander Puzanov, Sibirian Branch of the Russian Academy of Sciences, Institute for Water & Environmental Problems (IWEP)
- Dr. Eileen Eckmeier, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Geographisches Institut
Kontakt
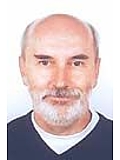
Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Frühauf (†)
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Naturwissenschaftliche Fakultät III
Institut für Geowissenschaften und Geographie
Von-Seckendorff-Platz 4
06120
Halle (Saale)
Tel.:+49 345 5526040
weitere Projekte
Die Daten werden geladen ...