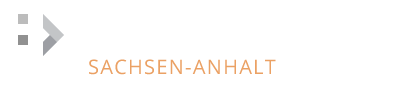Früherkennung von Hörschäden bei Patienten mit CIS-Platin-Chemotherapie
Projektleiter:
Projektbearbeiter:
T. Rahne,
S. Plontke
Finanzierung:
Haushalt;
Die routinemäßig verwendeten audiologischen diagnostischen Verfahren (z.B. das Tonaudiogramm) sind auf eine recht grobe Klassifikation von z. T. manifesten Hörstörungen ausgelegt. Geringe Änderungen des Hörstatus, die auf den Beginn einer einsetzenden Schwerhörigkeit hinweisen oder umgekehrt Hinweise auf eine vollständige Genesung geben können, lassen sich hingegen nur sehr schlecht treffen. Angesichts der großen Bedeutung eines intakten Hörsystems für die zwischenmenschliche Kommunikation auch in anspruchsvollen Hör-Umgebungen ist dagegen eine frühzeitige, sensitive Erkennung von beginnenden Hörschäden ( auditorisches Monitoring ) besonders dann wichtig, wenn durch entsprechende Gegenmaßnahmen eine weitere Hörschädigung verhindert werden kann, z.B. bei der Therapie mit ototoxischen Medikamenten. So werden durch Cisplatingabe in der Krebstherapie häufig die äußeren Haarzellen (ÄHZ) geschädigt. Bei Behandlungen mit Carboplatin zeigt sich bei niedrigen und mittleren Dosierungen im Tiermodell dagegen eine nahezu ausschließliche Schädigung innerer Haarsinneszellen. Die ÄHZ bleiben hingegen weitestgehend intakt und die durch die ÄHZ erzeugten otoakustischen Verzerrungsprodukte (DPOAE) bleiben erhalten. Vor diesem Hintergrund wäre ein sensitives auditorisches Monitoring von großem Wert, z. B. um Dosierung und Wirkstoffkombinationen optimal einzustellen und das Verhältnis zwischen IHZ- und ÄHZ-Schädigungen abschätzen zu können. Das zumeist eingesetzte Tonaudiogramm im Frequenzbereich 125 Hz bis 8 kHz ist dafür ungeeignet. Eine in letzter Zeit stärker untersuchte Alternative betrifft die Feinstruktur der Hörschwelle, deren Vorhandensein sehr sensitiv gegenüber Schädigungen des Gehörs ist. Bei reversiblen ototoxischen Belastungen verschwindet die Feinstruktur der Hörschwelle. Ein erfolgversprechender Ansatz für ein sensitiveres Monitoring ist neben der Hochtonaudiometrie die Verwendung otoakustischer Emissionen (OAE) unter Berücksichtigung des Generierungs-Mechanismus von DPOAE an zwei cochleären Quellen. Damit könnte sich die Möglichkeit bieten, durch isolierte Betrachtung der zweiten DPOAE-Komponente oder der detaillierten Betrachtung der DPOAE-Feinstruktur einen sensitiven Indikator für geringe Schädigungen zu haben.
Schlagworte
CIS-Platin, DPOAE, Feinstruktor, Otoakustische Emissionen, Tonschwellenaudiometrie
Kooperationen im Projekt
Kontakt

Prof. Dr. Torsten Rahne
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Universitätsklinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie
Ernst-Grube-Str. 40
06120
Halle (Saale)
Tel.:+49 345 5575362
weitere Projekte
Die Daten werden geladen ...