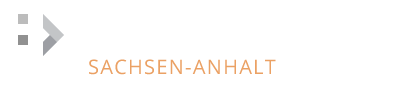Das Management unternehmerischer Material-, Kohlenstoff- und Energieflüsse wird zunehmend zum strategischen Wettbewerbsfaktor. Nicht nur die unmittelbaren physischen Risiken, welche in Folge des fossilen Ressourcenverbrauches und der Emissionen die unmittelbare Existenz des Unternehmens bspw. durch die Verschärfung des Klimawandels bedrohen, sondern auch marktliche, regulatorische und gesellschaftliche Risiken und Treiber (Carbon Constraints) zwingen Unternehmen zunehmend Energie-, Material- und Kohlenstoffflussströme abzubilden und zu steuern. Energie- und vor allem Materialkosten verursachen mit steigender Tendenz ca. 50 Prozent der Gesamtkosten des produzierenden Gewerbes in Deutschland. Dabei sind insbesondere Energiekosten stark volatil, was zu hohen Beschaffungs- und Preisrisiken führt. Der sichere Zugriff auf Rohstoffe und Energieträger ist aus Sicht der deutschen Wirtschaft eine der wichtigsten Herausforderungen und wird als Konjunkturrisiko wahrgenommen. Die o.g. Constraints, welche zunehmend gewichtiger unternehmerische Entscheidungen beeinflussen, werden sich weiter verschärfen, wodurch deren Beachtung prioritäre Managementaufgabe ist/wird. Die Kostenwirkungen dieser Flussströme sind immens. So sind Unternehmen gezwungen CO2-Emissionen wertorientiert ("CO2-Performance") und effizient ("CO2-Efficiency") einzusetzen. Externe Kosten der CO2-Emissionen werden zunehmend internalisiert. Die betriebswirtschaftliche Forschung kennt eine Reihe an Instrumenten, welche diese einzelnen Aspekte aufgreifen und versuchen Verbesserungspotenziale zu erschließen. Die Interdependenzen zwischen Energie- und Materialinanspruchnahme und Kosten- und Emissionswirkungen sind kaum zu unterschätzen. Das Flussmanagement entfaltet dabei erheblich stärkere Veränderungskraft als bspw. das Umweltmanagement. Flusskosten werden in den Prozessen determiniert. Material- und Energieverbrauch und die darin verkörperten Emissionen sind die wichtigsten Kostentreiber der (produzierenden) Wirtschaft. Aus diesem Grund ist die Integration der verschiedenen Aspekte und (Aus-)wirkungen im Rahmen eines Instrumentariums ein geeigneter Weg, sowohl um ökonomische als auch ökologische Erfolgspotenziale zu erschließen. Die sich hieraus ergebende Zielstellung der Ökoeffizienz ist für sich allein betrachtet eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist ein entsprechendes Instrument in ein betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement mit entsprechendem nachhaltigkeitsorientierten Wertekanon einzubetten, um "echte" Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung zu generieren. Das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit ist somit Ökoeffektivität und Ökoeffizienz. Folglich stellt sich an ein integriertes Instrument das operative Ziel der Ökoeffizienz und eingebunden in ein betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement jenes der Ökoeffektivität. Es soll insbesondere ein Instrument entwickelt werden, das den Brückenschlag zwischen Ökologie und Ökonomie in betrieblichen Produkten und Prozessen systematisch vollzieht und beim Füllen eines Vakuums in der Forschungslandschaft hilft. Die zentrale Forschungsfrage lautet:
Wie können Material-, Energie- und Carbonflussströme integriert ökoeffizient und ökoeffektiv gemessen und gesteuert werden?
Schlagworte

Prof. Dr. Hans-Ulrich Zabel
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich - School of Economics and Business
Große Steinstr. 73
06108
Halle (Saale)
Tel.:+49 345 5523428