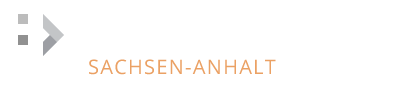Bei Zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGO) ist das anders. Sie bieten Güter an, bei denen die beiden Kundenfunktionen getrennt sind und unterschiedlichen Personenkreisen zugewiesen werden. Da die Nutznießer sich entweder gar nicht oder nur teilweise an der Kostendeckung beteiligen - Beispiel: Katastrophenopfer, die Hilfsleistungen erfahren -, sind ZGO darauf angewiesen, dass ehrenamtliche Mitarbeiter, Spender und Sponsoren Ressourcen zur Verfügung stellen.
Das bedeutet: Die bilateralen Beziehungen zwischen Kunden und Unternehmen nehmen im Fall Zivilgesellschaftlicher Organisationen die Form einer Dreiecksbeziehung an, weil es sich bei Nutznießern und Ressourcengebern um unterschiedliche Gruppen handelt. Hierdurch entstehen besondere Governance-Probleme: Die Nutznießer können die Quantität und Qualität der Leistungen einschätzen, haben aber kein Sanktionspotential, um eine Korrektur von Fehlleistungen zu bewirken. Umgekehrt verfügen die Ressourcengeber zwar über das nötige Sanktionspotential; allerdings fehlt es ihnen an Informationen, um sinnvoll eingreifen zu können.
Dies stellt die moralische Integrität Zivilgesellschaftlicher Organisationen vor große Herausforderungen: Wie können sie sich ihren Ressourcengebern gegenüber glaubwürdig darauf verpflichten, die Bedürfnisse der Nutznießer befriedigen zu wollen, obwohl sie von diesen (anders als Unternehmen von ihren Kunden) für etwaige Fehlleistungen nicht durch Zahlungsentzug bestraft werden können?
Um die moralische Integrität von Unternehmen zu fördern und ihr Wertschöpfungsverhalten nachhaltig auszurichten, hat die Ordonomik eine Strategiematrix entwickelt, mit der man soziale Dilemmastrukturen identifizieren und so ausgeschöpfte Win-Win-Potentiale aufspüren kann. Ziel des Forschungsprojekts ist es, das ordonomische Instrumentarium auf das Wertschöpfungsverhalten von Zivilgesellschaftlichen Organisationen zu übertragen. Untersucht werden soll, inwiefern auch sie in der Lage sind, moralische Bindungen als "Produktionsfaktor" einzusetzen: als eine kluge Investition in Regelarrangements, die sich "bezahlt" machen, weil sie die moralische Integrität der eigenen Organisation und damit ihre Attraktivität als Kooperationspartner erhöhen, so dass Ethik und Ökonomik hier gewissermaßen Hand in Hand gehen können.

Prof. Dr. Ingo Pies
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich - School of Economics and Business
Große Steinstr. 73
06108
Halle (Saale)
Tel.:+49 345 5523420